"Die
unterzeichnenden Professoren sind der Auffassung, daß
die Kunstakademie einer sie in ihrer Existenz bedrohenden
Krise entgegengeht. Urheber dieser die innere wie die äußere
Ordnung der Hochschule gefährdenden und die Arbeitsfähigkeit
 ihrer
Mitglieder in Frage stellenden Entwicklung ist ein Ungeist,
der im wesentlichen aus dem Ideenkreis und dem Einfluß
von Herrn Joseph Beuys stammt. Anmaßender politischer
Dilettantismus, Sucht nach weltanschaulicher Bevormundung,
demagogische Praktik und - in ihrem Gefolge - Intoleranz,
Diffamierung und Unkollegialität zielen auf die Auflösung
gegenwärtiger Ordnungen, greifen störend in künstlerische
und pädagogische Bereiche ein und erniedrigen, bewußt
verletzend, menschliche Werte. Wir bestreiten weder den
künstlerischen Rang von Herrn Joseph Beuys, noch verkennen
wir die von ihm ausgehende Faszination. Diese seine Fähigkeiten
wie auch die von ihm eingenommene künstlerische Position
könnten für die Hochschule von großem Nutzen
sein, wären sie nicht gekoppelt mit einem sich immer
deutlicher dokumentierenden Willen nach Macht und nach potentiellem
Übergewicht innerhalb der Hochschule. Indem er seine
Klasse zum Agitationszentrum macht, benutzt er diese nicht
nur zur Ausweitung seiner Einflußnahme auf unser Haus
und dessen Lehrbetrieb, sondern er benutzt die Hochschule
selbst als ein Mittel zur Weiterleitung seiner Ideen in
die Gesellschaft. Mit Hilfe der Deutschen Studentenpartei,
deren Gründer er ist, hat Joseph Beuys einen bedenklichen
Einfluß auf die Reformbewegung unserer Hochschule
genommen.
ihrer
Mitglieder in Frage stellenden Entwicklung ist ein Ungeist,
der im wesentlichen aus dem Ideenkreis und dem Einfluß
von Herrn Joseph Beuys stammt. Anmaßender politischer
Dilettantismus, Sucht nach weltanschaulicher Bevormundung,
demagogische Praktik und - in ihrem Gefolge - Intoleranz,
Diffamierung und Unkollegialität zielen auf die Auflösung
gegenwärtiger Ordnungen, greifen störend in künstlerische
und pädagogische Bereiche ein und erniedrigen, bewußt
verletzend, menschliche Werte. Wir bestreiten weder den
künstlerischen Rang von Herrn Joseph Beuys, noch verkennen
wir die von ihm ausgehende Faszination. Diese seine Fähigkeiten
wie auch die von ihm eingenommene künstlerische Position
könnten für die Hochschule von großem Nutzen
sein, wären sie nicht gekoppelt mit einem sich immer
deutlicher dokumentierenden Willen nach Macht und nach potentiellem
Übergewicht innerhalb der Hochschule. Indem er seine
Klasse zum Agitationszentrum macht, benutzt er diese nicht
nur zur Ausweitung seiner Einflußnahme auf unser Haus
und dessen Lehrbetrieb, sondern er benutzt die Hochschule
selbst als ein Mittel zur Weiterleitung seiner Ideen in
die Gesellschaft. Mit Hilfe der Deutschen Studentenpartei,
deren Gründer er ist, hat Joseph Beuys einen bedenklichen
Einfluß auf die Reformbewegung unserer Hochschule
genommen. Die studentische Vertretung, deren Mitwirkung und Mitbestimmung
von der Professorenschaft gemeinsam mit den Vertretern der
Assistenten und Dozenten in unserem Hause versuchsweise
eingeführt wird, verfällt zunehmend utopischen
und anarchistischen Argumentationen und wird zum Sprachrohr
dieser Ideologie. Konferenzen arten aus in pseudopolitisches
Geschwätz und provokatorische Kritik, die sich zu unrealistischen
Forderungen steigern, wobei eine offene Feindseligkeit gegen
die parlamentarische Demokratie zutage tritt. Das Kollegium
hat Herrn Joseph Beuys mehrfach - anfangs noch einstimmig,
dann aber über viele Bedenken hinweg - das Vertrauen
ausgesprochen. Angesichts der heutigen alarmierenden Situation
halten wir eine Überprüfung des Vertrauensverhältnisses
für notwendig. Wir selbst erklären, daß
wir Herrn Joseph Beuys unser Vertrauen entziehen müssen."
Die studentische Vertretung, deren Mitwirkung und Mitbestimmung
von der Professorenschaft gemeinsam mit den Vertretern der
Assistenten und Dozenten in unserem Hause versuchsweise
eingeführt wird, verfällt zunehmend utopischen
und anarchistischen Argumentationen und wird zum Sprachrohr
dieser Ideologie. Konferenzen arten aus in pseudopolitisches
Geschwätz und provokatorische Kritik, die sich zu unrealistischen
Forderungen steigern, wobei eine offene Feindseligkeit gegen
die parlamentarische Demokratie zutage tritt. Das Kollegium
hat Herrn Joseph Beuys mehrfach - anfangs noch einstimmig,
dann aber über viele Bedenken hinweg - das Vertrauen
ausgesprochen. Angesichts der heutigen alarmierenden Situation
halten wir eine Überprüfung des Vertrauensverhältnisses
für notwendig. Wir selbst erklären, daß
wir Herrn Joseph Beuys unser Vertrauen entziehen müssen."
Manifest
der Professoren an der Kunstakademie Düsseldorf vom
12 November 1968, unterzeichnet von
Gert Weber,
Norbert Kricke, Karl Bobeck, Walter Breker, K. O. Götz,
Gerhard Hoehme, Günter Grote, Karl Robaschik,  Manfred
Sieler, Rolf Sackenheim
Manfred
Sieler, Rolf Sackenheim
Beuys antwortet
seinen Widersachern: "Ihr fühlt euch gestört,
weil ihr unfruchtbar seid".
Joseph
Beuys war 1961 als Nachfolger Josef Magers an die Düsseldorfer
Kunstakademie berufen worden, obwohl sein ehemaliger Lehrer,
der Bildhauer Ewald Mataré, gewarnt hatte: "Ihr
wollt doch nicht Beuys berufen, der ist doch verrückt".
Bis dahin eher "stumm", entdeckte Beuys als
Akademielehrer die Macht des Wortes, der Sprache. Das
fortwährende intensive Gespräch mit seinen Schülern
wurde zentraler Bestandteil des "erweiterten Kunstbegriffs",
dessen Kristallisationspunkt die "Soziale Plastik"
als gesellschaftliches Kunstwerk ist, das die kreativen
Kräfte des einzelnen mobilisiert und erst die Voraussetzung
für wirkliche Demokratie schafft.
Beuys vertrat
den Standpunkt, dass jeder, der Kunst studieren wolle,
auch Kunst studieren solle. Er ignorierte den "Numerus clausus" und nahm jeden in seine Klasse auf, auch
und gerade diejenigen Bewerber, die seine Kollegen zuvor
abgelehnt hatten. Beuys lehnte das Mappenverfahren ab
und plädierte für zwei, allenfalls drei Probesemester,
um die Begabung der Bewerber auf diese Weise zu ermitteln.
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um seine
Person hatte er zeitweise 400 Schüler. Damit ging
er - recht bewußt - an die Substanz der Akademie.
clausus" und nahm jeden in seine Klasse auf, auch
und gerade diejenigen Bewerber, die seine Kollegen zuvor
abgelehnt hatten. Beuys lehnte das Mappenverfahren ab
und plädierte für zwei, allenfalls drei Probesemester,
um die Begabung der Bewerber auf diese Weise zu ermitteln.
Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um seine
Person hatte er zeitweise 400 Schüler. Damit ging
er - recht bewußt - an die Substanz der Akademie.
Bei Beuys
verdichtet sich immer mehr der Ideenzusammenhang einer
"Freien Internationalen Universität" als
einer umfassenden "Sozialen Plastik". Er hat
eine "Freie Hochschule" im Visier, in der die
Studierenden Kreativität als Gestaltung von Freiheit
erfahren können. Unter Ausschluss jeglicher Bevormundung
und Beachtung des Prinzips der Selbstbestimmung sowie
der Angliederung eines internationalen Kommunikationszentrums
sollen nicht nur Künstler und Kunsterzieher ausgebildet,
sondern zahlreiche Disziplinen in vielfältiger Weise
zusammengeführt werden.
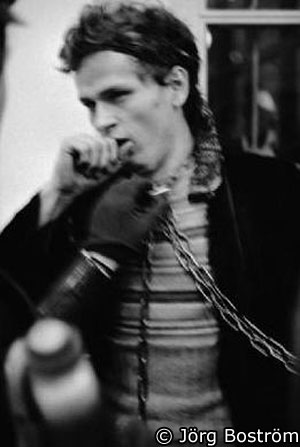 Beuys
ist von Anfang an nicht nur Lehrer, "sondern auch
ein rasch und immer stärker ausgreifender Aktionist,
der zwischen Außen- und Innentätigkeit freilich
keine Unterschiede macht. Das heißt: Auch draußen
ist Akademie, und die Akademie ist selbstverständlich
Aktion. Der introvertierte Beuys hat aufgehört zu
existieren" (Stachelhaus). Beuys sagte kurz und bündig:
"Wo ich bin, ist Akademie". Nach einer Auseinandersetzung
beim Festival der neuen Kunst am 20. Juli 1964 in der
Aula der Technischen Hochschule Aachen, bei der der blutiggeschlagene
Beuys ein Kruzifix hochhält, soll der damalige Bundespräsident
Heinrich Lübke gegenüber dem Düsseldorfer
Kultusminister geäußert haben, ein solcher
Mann könne doch nicht Professor sein. Beuys wird
jedenfalls nicht Beamter, sein Dienstvertrag als angestellter
Professor wird von Zeit zu Zeit verlängert.
Beuys
ist von Anfang an nicht nur Lehrer, "sondern auch
ein rasch und immer stärker ausgreifender Aktionist,
der zwischen Außen- und Innentätigkeit freilich
keine Unterschiede macht. Das heißt: Auch draußen
ist Akademie, und die Akademie ist selbstverständlich
Aktion. Der introvertierte Beuys hat aufgehört zu
existieren" (Stachelhaus). Beuys sagte kurz und bündig:
"Wo ich bin, ist Akademie". Nach einer Auseinandersetzung
beim Festival der neuen Kunst am 20. Juli 1964 in der
Aula der Technischen Hochschule Aachen, bei der der blutiggeschlagene
Beuys ein Kruzifix hochhält, soll der damalige Bundespräsident
Heinrich Lübke gegenüber dem Düsseldorfer
Kultusminister geäußert haben, ein solcher
Mann könne doch nicht Professor sein. Beuys wird
jedenfalls nicht Beamter, sein Dienstvertrag als angestellter
Professor wird von Zeit zu Zeit verlängert.
Vor dem
Hintergrund der Auseinandersetzungen um den Schahbesuch
Anfang Juni 1967 in Berlin und dem Tod des Studenten Benno
Ohnesorg gründet Beuys einige Monate danach die "Deutsche
Studentenpartei" (später umbenannt in "Fluxus
Zone West"), die so heiße, weil jeder Mensch
ein Student sei, und die als "Partei gegen Parteien"
zu verstehen sei. Mit seiner Studentenpartei, zu deren
Mitbegründern auch der Beuys-Schüler und AStA-Sprecher
Johannes Stüttgen gehört, arbeitet Beuys auf
eine Umstrukturierung der Akademie im Sinne des "erweiterten
Kunstbegriffs" hin und provoziert damit beträchtlichen
Widerstand bei einem großen Teil der Akademieprofessoren,
die schließlich im November 1968 ihr Manifest gegen
Beuys verfassen und ihm das Vertrauen entziehen.
Ein halbes
Jahr davor war es an der Kunstakademie zu einer krisenhaften
Zuspitzung gekommen. Die Beuys-Schüler Chris Reinecke und Jörg Immendorff hatten die "Lidl"-Akademie
gegründet. Ihr Ziel unter anderem: Künstlerische
Arbeit in der Öffentlichkeit, Erweiterung des Bewußtseins
aller. Im Flur der Kunstakademie stellen Studenten ein
Papphaus auf, die "Lidl"-Klasse, in der Informationen
und Arbeitsanweisungen ausgegeben werden. Als Ziel der
Aktion ist die Umstrukturierung der Düsseldorfer
Kunstakademie im Beuysschen Sinne unverkennbar. Professoren
werden nicht gefragt, die Studenten nehmen sich das Recht,
ihr Leben und ihr Lernen selbst zu gestalten. Der Direktor
der Kunstakademie, Eduard Trier, widersetzt sich dem Ansinnen
der "Lidl"-Leute, die Akademieräume bei
allen Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
ohne Einschränkung zu öffnen. Er weigert sich,
einer für den Mai 1969 geplanten internationalen
Arbeitswoche der "Lidl"-Akademie Arbeitsräume
zur Verfügung zu stellen. Beuys und zwei weitere
Professoren bieten ihre Klassenräume an, worauf Direktor
Trier die "Lidl"-Arbeitswoche untersagt und
Immendorff Hausverbot erteilt. Die nun illegale "Anti-Akademie
im Schoß der Akademie" (Thwaites) geht im Raum
von Beuys weiter, worauf Trier am 5. Mai die Polizei ruft.
Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze und am
7. Mai fordert Direktor Trier die "Lidl"-Anhänger
definitiv auf, das Akademiegebäude zu verlassen.
Als die Lage sich zuspitzt, wird Beuys gerufen, dem es
in einer Vollversammlung gelingt, die "Lidl"-Studenten
zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen, so dass die
präsente Polizei nicht eingreifen muss.
Reinecke und Jörg Immendorff hatten die "Lidl"-Akademie
gegründet. Ihr Ziel unter anderem: Künstlerische
Arbeit in der Öffentlichkeit, Erweiterung des Bewußtseins
aller. Im Flur der Kunstakademie stellen Studenten ein
Papphaus auf, die "Lidl"-Klasse, in der Informationen
und Arbeitsanweisungen ausgegeben werden. Als Ziel der
Aktion ist die Umstrukturierung der Düsseldorfer
Kunstakademie im Beuysschen Sinne unverkennbar. Professoren
werden nicht gefragt, die Studenten nehmen sich das Recht,
ihr Leben und ihr Lernen selbst zu gestalten. Der Direktor
der Kunstakademie, Eduard Trier, widersetzt sich dem Ansinnen
der "Lidl"-Leute, die Akademieräume bei
allen Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
ohne Einschränkung zu öffnen. Er weigert sich,
einer für den Mai 1969 geplanten internationalen
Arbeitswoche der "Lidl"-Akademie Arbeitsräume
zur Verfügung zu stellen. Beuys und zwei weitere
Professoren bieten ihre Klassenräume an, worauf Direktor
Trier die "Lidl"-Arbeitswoche untersagt und
Immendorff Hausverbot erteilt. Die nun illegale "Anti-Akademie
im Schoß der Akademie" (Thwaites) geht im Raum
von Beuys weiter, worauf Trier am 5. Mai die Polizei ruft.
Am nächsten Tag wiederholt sich das Ganze und am
7. Mai fordert Direktor Trier die "Lidl"-Anhänger
definitiv auf, das Akademiegebäude zu verlassen.
Als die Lage sich zuspitzt, wird Beuys gerufen, dem es
in einer Vollversammlung gelingt, die "Lidl"-Studenten
zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen, so dass die
präsente Polizei nicht eingreifen muss.
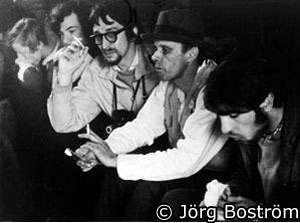 Immendorff
setzt die Internationale Arbeitswoche in einem Zelt vor
der Kunstakademie fort. Auf Anordnung des Wissenschaftsministers
wird die Akademie für fünf Tage geschlossen.
Immendorff
setzt die Internationale Arbeitswoche in einem Zelt vor
der Kunstakademie fort. Auf Anordnung des Wissenschaftsministers
wird die Akademie für fünf Tage geschlossen.
Nachdem
die Akademieprofessoren im November 1968 Beuys ihr Vertrauen
entzogen hatten, setzte der Akademieprofessor Norbert
Kricke mit einem Artikel in der ZEIT vom 20. Dezember
1968 nach. Krickes Polemik gegen Beuys soll hier in vollem
Wortlaut wiedergegeben werden, weil der Text mit seiner
Zuspitzung die eigenartige und einzigartige Stellung von
Beuys im Gefüge der Akademie viel mehr noch als das
Professorenmanifest in der Spiegelung eines Gegners atmosphärisch
verdichtet:
"Der
Fall Beuys ist kein Fall, vielmehr ist er eine elende
Geschichte vom grotesken Eifer schneller Skribenten, mangelhaft
und einseitig informiert, zu eilig, zu schwärmend,
zu viel Trompete, zu viel auf die Pauke. Es gibt eben
doch viel mehr Werber und Publizisten als kritische Geister
im Lande, und das beunruhigt mich.
Warum alarmiert
Beuys die Presse, warum spielt er verfolgt? Es ist gar
nicht verwunderlich, wenn sich Künstler, die im gleichen
Hause lehren, belästigt und geelendet fühlen
durch Beuys, der mit telepathischen Aktionen und metaphysischem
Fanatismus die Akademie benutzt, um sich zu zelebrieren,
um sich zu verwirklichen, um Stimmen zu sammeln für
seine Zwecke.
Die ersten
Opfer dieser Taktik waren die Professoren selber. Beuys
konnte ihnen seit Jahren suggerieren, sich rückhaltlos
für seine Verbeamtung einzusetzen. Halb in Trance
wiederholten zwanzig Hochschullehrer eine Solidaritätskundgebung
nach der anderen für ihren Kollegen - nicht so der
Schreiber.
Erst vor
kurzem erwachte die Lehrerschar, fast die Hälfte
stellte sich gegen Beuys, und da überfiel ihn die
Angst. Er lief von Presse zu Presse und fand manche bereit,
in seine Dienste einzutreten.
 Was
kümmerten die Kritiker Strelow und Jappe allseitige
Information, Vollständigkeit der Tatsachen?
Was
kümmerten die Kritiker Strelow und Jappe allseitige
Information, Vollständigkeit der Tatsachen?
Das meiste
wurde inzwischen richtiggestellt, Falsches ausgeräumt
und Fehlendes ergänzt. Was bleibt, ist das Schwärmen,
die kritiklose Begeisterung. Ich dämpfe die Trompete
von Herrn Jappe, ich kann nicht dafür, wenn er nicht
darüber nachdenkt, was pädagogische Tätigkeit
und Wirkung sind. Ich kann nicht dafür, wenn er die
Vielzahl der Schüler als Beweis dafür ansieht,
dass der Lehrer gut sein muss. Herr Jappe kann aber dafür,
dass er Jünger für Schüler und einen Prediger
für einen Pädagogen hält.
Dieser Unterschied
hätte schon im geistigen Vorfeld von Herrn Jappes
schneller Feder geklärt sein sollen. Es ist nicht
pädagogisch, jungen künstlerischen Menschen,
unsicher und tastend im eigenen Wuchs, Patentschlüssel
fürs Leben zu geben, mit denen sie doch nur die Schlösser
öffnen, die der Meister selbst gebaut hat.
Schwarm,
Rausch und gemeinsame Heilsgesänge sollte man nicht
verwechseln mit künstlerischer Arbeit, die Lehrende
und Lernende betreiben, mit dem freien geistigen Spiel,
mit dem Dialog, der dem jungen Künstler hilft, seine
Persönlichkeit zu bilden.
Beuys und
seine Schüler schwärmen. Fanatisierte Jünger
des Meisters durchlaufen die Akademie wie ferngelenkte
Medien, tuscheln und rascheln und zeigen eine insektenhafte
Aktivität, sind clever, eifrig und emsig wie Maos
kleine Chinesen.
Es ist
ein reges Getue, das kann man wohl sagen, auf Fluren,
in Klassen, auf Treppen, in Aula und Mensa, an Wänden
und Türen all over: Beuys, seine Partei, halb auch
sein AstA, wenig von Kunst.
Dieses Gewispere
in der Akademie, das Hin und Her, das Auseinanderlaufen,
sich in Ecken sammeln, das An- und Abschwellen von Geräuschen,
das Presse-rein und Presse-raus, die Zettelwirtschaft
- all das ist nicht schlecht. Es hat etwas Phantastisches
und unterbricht in reizvoller Lebendigkeit das  Pathos
unseres Hauses. Nicht ohne Spaß zu sehen, wie Pförtner
und Bedienstete mit sogenanntem gesunden Menschenverstand
dieser Sache begegnen, Finger an die Schläfe legen,
Augen hoch zum Himmel.
Pathos
unseres Hauses. Nicht ohne Spaß zu sehen, wie Pförtner
und Bedienstete mit sogenanntem gesunden Menschenverstand
dieser Sache begegnen, Finger an die Schläfe legen,
Augen hoch zum Himmel.
Beuys liebt
die Akademie, er liebt sie auf seine Art, doch mich macht
es nachdenklich, wenn ein Künstler von heute nicht
ohne Gefolgschaft und bergende Institution leben kann,
wenn er die Akademie als Zuflucht und Heim benutzt und
sich an sie klammert. Er braucht sie und gebraucht sie.
So sieht er also aus, "der westdeutsche Avantgardist
und mutigste Künstler unserer Zeit", er spannt
sie alle für sich ein, Galeristen, Kirchenfürsten,
Presse, Rundfunk, Fernsehschau fordern seine Verbeamtung.
Angst scheint
seine Triebkraft zu sein, sie sitzt tief und überall
bei ihm: Technik ist böse, Heute ist böse, Autos
sind schrecklich, Computer unmenschlich, Fernseher auch,
Raketen sind furchtbar, Atome gespalten zerrütten
die Welt, Flucht in das Gestern, Besserung der Menschen,
Sehnsucht nach rückwärts: altes Gerät,
Kordeln mit Gebündeltem, Staub und Filz, Befettetes,
Wachs und Holz, mürbes Gewebe, Trockenes und Geschmolzenes,
alles serviert er grau, braun und schwarz wie dunkel gewordene
alte Gemälde, Museumsstaub, Museumsgeruch an allen
Objekten schon bei der Entstehung, dämmrig und wenig
belüftet die Welt seiner Dinge; dauerndes Spiel,
Versteck im Versteck, Wachs auf der Kiste, Fett im Eck,
in den Teppichrollen qualvoll lange drinnen bleiben: Er
nimmt es auf sich für uns alle. Das ist sein Anspruch:
Vertreter im Leiden, er spielt den Messias, er will uns
bekehren, er will die Akademie die Rolle der Kirchen übernehmen
lassen - das ist für mich sein Jesus-Kitsch.
Die ersatzkünstlerische,
ausweichende, formlose Sendung und Heilandsmanier steigert
sich ins Unerträgliche. Auch die Politik soll besser werden, nicht mehr lügen, Wahrheit
sagen, Gutes tun und Händchen halten. Phrasen zur
Verbesserung, Heilsverkündung, Nächstenliebe.
Politik soll besser werden, nicht mehr lügen, Wahrheit
sagen, Gutes tun und Händchen halten. Phrasen zur
Verbesserung, Heilsverkündung, Nächstenliebe.
Anders
der Künstler in seinen Aktionen: Hasenschlachten,
Blutgeschmiere im Gesicht und an die Wände, und zum
Hasen selbst verwandelt nimmt Kontakt er auf zum "Geist".
Spiritismus und Beschwörung, Opferszenen vor den
Heiden, all dieses ist Ausdruck seiner Sehnsucht nach
Vergangenheit, die ihn befreit vom Druck und der Bedrohung,
wie er sie durch die Gegenwart zu erfahren glaubt. Er
kommt vom linken Niederrhein, der auch seine geistige
Heimat geblieben ist.
Wie weit
gefasst, wie künstlerisch sind Rauschenberg und Oldenburg,
wie viel größer das künstlerische Volumen,
wie viel lebendiger die Intelligenz bei Dali und Tanguy,
wie viel mehr Mut, wie groß ihr Humor. Wir fliegen
und haben das Auto, es rechnen die Computer, wir landen
auf dem Mond - all das ist garnichts?
Kunst bringt
uns Neues, Beuys bringt Altes. Wenn unsere Welt aus seinen
Materialien gebaut wäre, sie wäre aus Pappe,
Filz und Papier und geistig noch mehr von gestern. Nicht
ein Phänomen unseres Jahrhunderts hat er in Form
gebracht - Weltanschauung, Gruppengeist, Gemeinschaftsfieber
gelten nicht für Form, die er uns schuldig bleibt.
Er gibt von allem ein bisschen, vom Kalten, vom Warmen,
vom Kreuz und vom Blut, vom Guten, vom Bösen - und
alles ganz sentimental. Beuys ist kein Fall, wenigstens
kein künstlerischer, er scheint ein Fall zu sein
für Soziologen, Politologen, Theologen, Mythologen
- and last but not least Beamtologen."
Soweit
Krickes Polemik in der ZEIT.
 Als
1971 an der Düsseldorfer Kunstakademie wieder 142
Bewerber für das künstlerische Lehramt nicht
angenommen werden, nimmt Beuys im August 1971 alle abgewiesenen
Studienbewerber für ein Probesemester auf. Er schreibt
an Direktor Trier: "Jeder Versuch, unserer Klasse
einen Aufnahmemodus vorzuschreiben, weisen wir jetzt und
in Zukunft als rechtswidrigen Eingriff in die Lehrfreiheit
zurück. Das gilt auch für jede Vorschrift bezüglich
der Schülerzahl unserer Klasse. (Die Akademie ist
frei.) Dasselbe gilt für jede andere Vorschrift,
die das Prinzip dieser Freiheit antastet. Es ist also
möglich, dass ein Lehrer, der dazu willens ist, 142
Studenten zusätzlich aufnimmt, obgleich andere -
beamtete Lehrer - sich schon mit sechs Schülern oder
ähnlichen Zahlen ausgelastet fühlen. Kapazitätsfragen
der Akademie, Raummangel, Hauspersonalmangel, Lehrmittelmangel,
Lehrermangel etc. haben im Zusammenhang mit einer Aufnahmeregelung
nichts zu suchen. Für diese Mangelerscheinungen tragen
die zuständigen Behörden, ihre Beamten und letztlich
die über die Köpfe der Mehrheit hinwegherrschenden
Parteipolitiker den Betroffenen und dem ganzen Volk gegenüber
die volle Verantwortung. Der Numerus clausus ist grundrechtswidrig
und keine sachgerechte Lösung der Kapazitätsprobleme
..."
Als
1971 an der Düsseldorfer Kunstakademie wieder 142
Bewerber für das künstlerische Lehramt nicht
angenommen werden, nimmt Beuys im August 1971 alle abgewiesenen
Studienbewerber für ein Probesemester auf. Er schreibt
an Direktor Trier: "Jeder Versuch, unserer Klasse
einen Aufnahmemodus vorzuschreiben, weisen wir jetzt und
in Zukunft als rechtswidrigen Eingriff in die Lehrfreiheit
zurück. Das gilt auch für jede Vorschrift bezüglich
der Schülerzahl unserer Klasse. (Die Akademie ist
frei.) Dasselbe gilt für jede andere Vorschrift,
die das Prinzip dieser Freiheit antastet. Es ist also
möglich, dass ein Lehrer, der dazu willens ist, 142
Studenten zusätzlich aufnimmt, obgleich andere -
beamtete Lehrer - sich schon mit sechs Schülern oder
ähnlichen Zahlen ausgelastet fühlen. Kapazitätsfragen
der Akademie, Raummangel, Hauspersonalmangel, Lehrmittelmangel,
Lehrermangel etc. haben im Zusammenhang mit einer Aufnahmeregelung
nichts zu suchen. Für diese Mangelerscheinungen tragen
die zuständigen Behörden, ihre Beamten und letztlich
die über die Köpfe der Mehrheit hinwegherrschenden
Parteipolitiker den Betroffenen und dem ganzen Volk gegenüber
die volle Verantwortung. Der Numerus clausus ist grundrechtswidrig
und keine sachgerechte Lösung der Kapazitätsprobleme
..."
Das Wissenschaftsministerium
reagiert prompt und erklärt, die 142 Bewerber werden
in Düsseldorf keine Zulassung erhalten. Das Ministerium
werde ihnen ein Studium an einer geplanten Entlastungsakademie
im westfälischen Raum (Münster) anbieten.
Beuys kämpft
weiter um die Zulassung der 142 Bewerber und besetzt am
15. Oktober 1971 mit einer Studentengruppe das Sekretariat
der Akademie, wobei er die Herausgabe von Studienbüchern
verlangt. Nach Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium
und gewissen Zusagen räumen Beuys und die Studenten
das Sekretariat.
Im Sommer
1972 wiederholt sich das Spiel. 125 Studienbewerber werden
abgewiesen. Beuys erklärt umgehend, er werde allen
125 abgelehnten Studenten Gelegenheit zur Aufnahme in
ein Probesemester seiner Klasse geben.
 Das
Wissenschaftsministerium fordert Ende August 1972 Unterlassung,
Beuys wiederum erklärt in einem offenen Brief vom
5. Oktober 1972, es sei unzulässig, andere Gesichtspunkte
als Anlage und Neigung der Schüler für die Aufnahme
in bestimmten Schulen gelten zu lassen. Er sei keineswegs
bereit, die hier erkennbaren Versäumnisse der Verantwortlichen
... ausgerechnet den benachteiligten jungen Menschen anzulasten.
Am 10. Oktober besetzt Beuys mit einer Studentengruppe
trotz einer Warnung des Wissenschaftsministeriums erneut
das Akademiesekretariat. Der Minister reagiert sofort.
Das
Wissenschaftsministerium fordert Ende August 1972 Unterlassung,
Beuys wiederum erklärt in einem offenen Brief vom
5. Oktober 1972, es sei unzulässig, andere Gesichtspunkte
als Anlage und Neigung der Schüler für die Aufnahme
in bestimmten Schulen gelten zu lassen. Er sei keineswegs
bereit, die hier erkennbaren Versäumnisse der Verantwortlichen
... ausgerechnet den benachteiligten jungen Menschen anzulasten.
Am 10. Oktober besetzt Beuys mit einer Studentengruppe
trotz einer Warnung des Wissenschaftsministeriums erneut
das Akademiesekretariat. Der Minister reagiert sofort.
"Düsseldorf,
den 10. Oktober 1972
Mit Schreiben
meines Vertreters vom 6.10.1972 sind Sie bereits darauf
hingewiesen worden, daß die Besetzung des Sekretariats
der Staatlichen Kunstakademie den strafrechtlichen Tatbestand
des Hausfriedensbruchs erfüllt und ich nicht gewillt
bin, solche strafbaren Handlungen hinzunehmen. In diesem
Schreiben ist Ihnen auch bereits eröffnet worden,
daß ich mich, sollte dies dennoch geschehen, zu
einer sofortigen Auflösung des Dienstverhältnisses
zum Lande Nordrhein-Westfalen genötigt sehen würde.
Trotz dieses Schreibens haben Sie heute seit 11 Uhr das Sekretariat mit etwa 60 bis 80 Personen besetzt
und weder den in meinem Auftrag gegebenen Hinweis meines
zuständigen Abteilungsleiters Ministerialdirigent
von Medem noch meine Ihnen um 14 Uhr zugeleitete Aufforderung
auf unverzügliche Räumung des Sekretariats befolgt.
Dieses Verhalten ist mit Ihren Pflichten als Landesbediensteter
und Professor der Staatlichen Kunstakademie unvereinbar.
Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses kann dem
Lande Nordrhein-Westfalen nicht mehr zugemutet werden.
Ich kündige daher mit sofortiger Wirkung gemäß
§ 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches den mit
Ihnen am 12. März 1969 abgeschlossenen Dienstvertrag.
Gleichzeitig fordere ich Sie erneut unter Hinweis auf
die Bestimmungen des Strafgesetzbuches auf, das Sekretariat
der Staatlichen Kunstakademie sofort zu räumen.
Uhr das Sekretariat mit etwa 60 bis 80 Personen besetzt
und weder den in meinem Auftrag gegebenen Hinweis meines
zuständigen Abteilungsleiters Ministerialdirigent
von Medem noch meine Ihnen um 14 Uhr zugeleitete Aufforderung
auf unverzügliche Räumung des Sekretariats befolgt.
Dieses Verhalten ist mit Ihren Pflichten als Landesbediensteter
und Professor der Staatlichen Kunstakademie unvereinbar.
Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses kann dem
Lande Nordrhein-Westfalen nicht mehr zugemutet werden.
Ich kündige daher mit sofortiger Wirkung gemäß
§ 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches den mit
Ihnen am 12. März 1969 abgeschlossenen Dienstvertrag.
Gleichzeitig fordere ich Sie erneut unter Hinweis auf
die Bestimmungen des Strafgesetzbuches auf, das Sekretariat
der Staatlichen Kunstakademie sofort zu räumen.
gez. Johannes
Rau
Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen"
Alle Fotos:
Jörg Boström
Text in Anlehnung
an Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, Econ Taschenbuch
im Ullstein Taschenbuchverlag, 2001
Fortsetzung